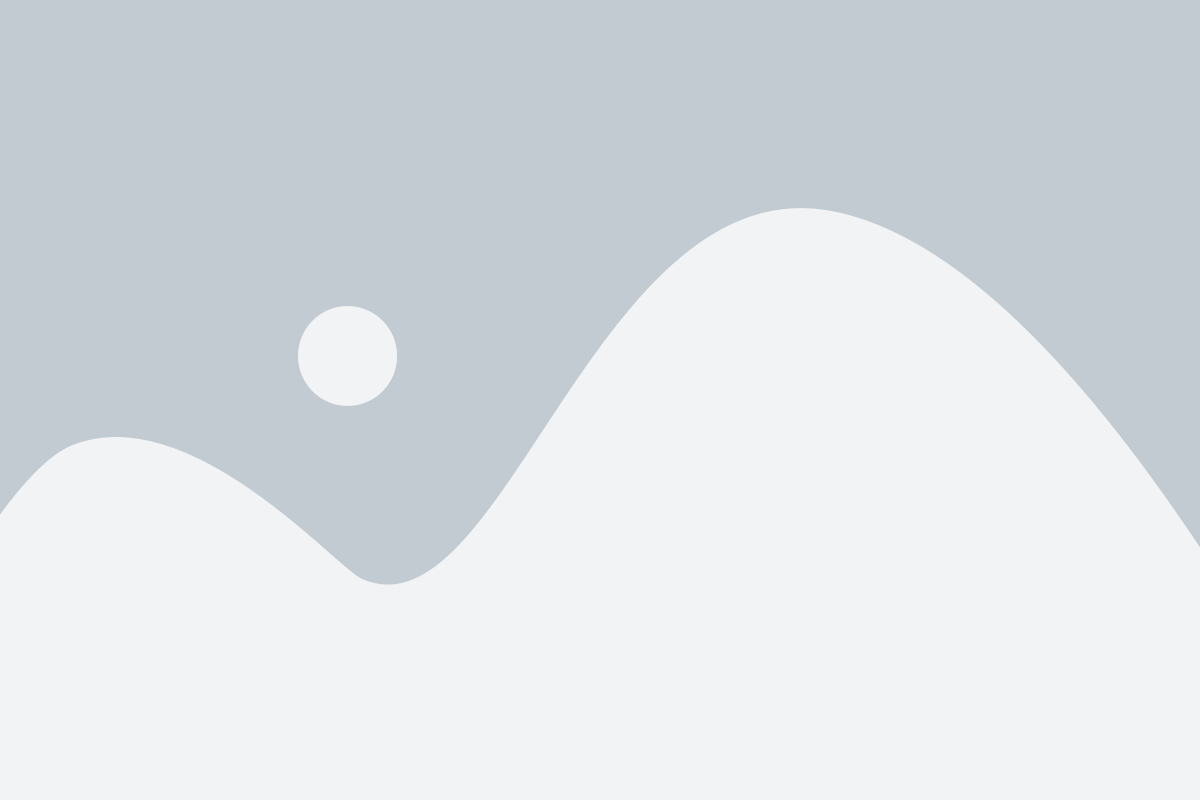
Gemeinwesenarbeit
Graefe – Kiez
Gemeinsam gestalten – solidarisch verändern
Die Gemeinwesenarbeit (GWA) im nördlichen Graefekiez gibt es seit dem Jahr 2000 – entstanden aus einem echten Bedarf: Engagierte Anwohner*innen und lokale Initiativen wandten sich damals an das Nachbarschaftshaus Urbanstraße e.V., weil sie Unterstützung suchten, um ihren Stadtteil lebenswerter und solidarischer zu gestalten. Seitdem ist viel passiert. Heute bringt die GWA Menschen zusammen, fördert den sozialen Zusammenhalt und setzt sich für eine gerechtere Stadtentwicklung ein – besonders für diejenigen, die oft übersehen werden.
Unsere Haltung – Haltung zeigen!
Unsere Arbeit hat sich in den letzten Jahrzehnten verändert – und sie musste sich verändern. Die gesellschaftlichen Krisen haben zugenommen, und ihre Auswirkungen sind längst in den Kiezen spürbar. Ob steigende Mieten, soziale Ungleichheit, Verdrängung oder die wachsende Zahl von Menschen, die auf der Straße leben, das Erstarken menschenfeindlicher Gesinnung und die Gefährdung unserer Demokratie – wir sehen es in unserem direkten Umfeld. Und mit diesen Veränderungen ist unsere Arbeit notwendigerweise politischer geworden.
Wir begleiten nicht nur Prozesse oder bleiben im Hintergrund. Als Gemeinwesenarbeiter*innen mit einem menschenrechtsbasierten Ansatz nehmen wir eine aktive Rolle ein, wenn es darum geht, gesellschaftliche Veränderungen anzustoßen.
Wir schaffen Strukturen, in denen sich Menschen engagieren können, halten Räume offen, in denen Mitgestaltung möglich ist – aber wir mischen uns auch ein, wo es nötig ist. Das ist für uns keine Frage der Neutralität, sondern der Haltung.Es geht um Glaubwürdigkeit: Wer sich für eine inklusive, demokratische Gesellschaft einsetzt, darf nicht nur beobachten – sondern muss mitgestalten. Deshalb sind wir nicht nur Berater*innen oder Moderator*innen, sondern auch Teil von Bündnissen und sozialen Bewegungen. Zum Beispiel, wenn es um bezahlbaren Wohnraum, Obdachlosigkeit oder Barrierefreiheit geht. Themen, die oft aus politischen Debatten ausgeblendet werden, weil sie nicht jede*n betreffen – aber sie betreffen immer jemanden. Wir bringen diese Perspektiven ein, zeigen Zusammenhänge auf und setzen uns dafür ein, dass niemand vergessen wird.
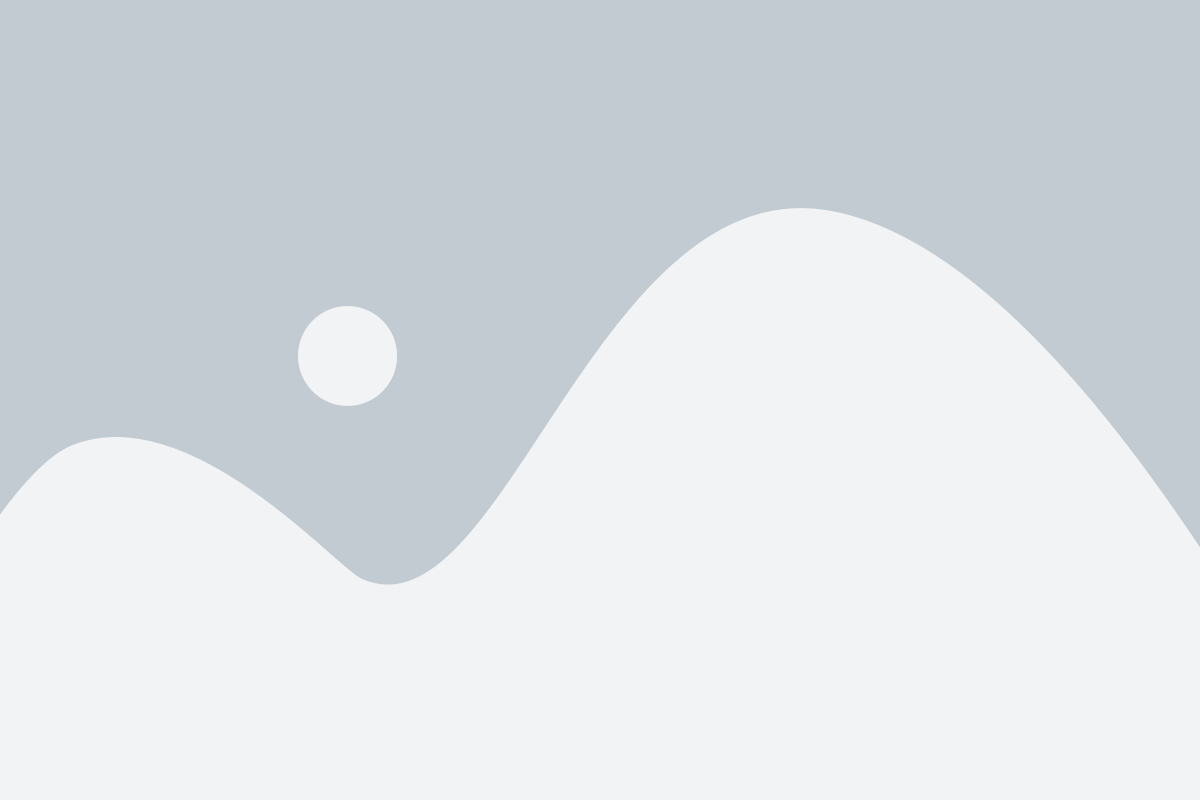
Konflikte aushandeln – aber fair
In unserer Arbeit begegnen wir oft Interessenskonflikten. Das gehört zu einer lebendigen Nachbarschaft dazu. Aber nicht alle haben die gleichen Möglichkeiten, ihre Anliegen durchzusetzen. Manche Perspektiven dominieren, andere werden überhört. Unsere Aufgabe ist es, das sichtbar zu machen.
Ein Beispiel: die barrierefreie Umgestaltung des Fraenkelufers. Einerseits ein wichtiger Schritt für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, andererseits standen Denkmalschutz und der Erhalt historischer Naturflächen im Raum. Solche Aushandlungsprozesse müssen inklusiv gestaltet werden – damit am Ende nicht nur die lautesten Stimmen gehört werden, sondern auch die, die sonst oft zu wenig Gehör finden.
Oder das „Mietenwahnsinns“-Bündnis: Eine starke Bewegung gegen steigende Mieten, aber das Thema Obdachlosigkeit oder die Situation von Menschen in Massenunterkünften spielte dort lange keine Rolle – weil viele Mieter*innen damit keine direkte Erfahrung hatten. Doch auch Wohnungslose sind Teil der Wohnungsfrage. Wir setzen uns dafür ein, dass solche Themen zusammengedacht werden, dass Bündnisse wachsen und sich neue Solidaritäten entwickeln.
Politisches Engagement und soziale Räume gehören zusammen
So politisch unsere Arbeit in den letzten Jahren geworden ist, so wichtig ist es auch, niedrigschwellige Orte der Begegnung zu erhalten. Gerade in Krisenzeiten braucht es Räume, die für alle zugänglich sind – unabhängig von sozialer Herkunft oder Lebenslage – Orte, an denen Menschen einfach zusammenkommen, ins Gespräch kommen oder einfach nur nebeneinander existieren können.
Denn Dialog ist eine Grundlage für ein solidarisches Miteinander. Aber er ist auch die Basis für ein gesundes, nachbarschaftliches Nebeneinander. Wir müssen nicht immer alles zusammen machen – aber wir können lernen, respektvoll nebeneinander zu leben.
In einer Nachbarschaft, in der sich Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen zwangsläufig begegnen, braucht es Räume, die das ermöglichen: Begegnung ohne Druck, Austausch ohne Zwang. Solche Räume sind unser beliebter Kiezflohmarkt, die Kiezkaffeetafel oder der Gemeinderundgang im Kiez im Rahmen der Begegnungstage rund um Glaube(n) in der Nachbarschaft.
Unsere Aufgabe ist es, beides zu ermöglichen: gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben und gleichzeitig Räume zu schaffen, in denen dieser Wandel sich entfalten kann.
Selbstwirksamkeit und politische Partizipation stärken
Ein weiteres Ziel unserer Arbeit ist es, Menschen in ihrer Selbstwirksamkeit zu unterstützen. Es geht darum, Räume zu schaffen, in denen sie ihre Anliegen formulieren und sich aktiv in politische Prozesse einbringen können.
Ein Beispiel ist die „Union für Obdachlosenrechte“ (UfO), die aus der direkten Zusammenarbeit mit obdachlosen Menschen entstanden ist. Diese Initiative konnte erstmals politische Aufmerksamkeit für die spezifischen Bedarfe und Rechte obdachloser Menschen generieren und in Dialog mit politischen Entscheidungsträger*innen treten.
Verändern heißt auch Verantwortung
übernehmen
Unsere Arbeit ist geprägt von dem Wissen, dass gesellschaftliche Strukturen nicht von allein gerechter werden. Sie müssen aktiv verändert werden. Deshalb sind wir nicht nur „Vermittlerinnen“, sondern manchmal auch Anwältinnen für diejenigen, die in politischen Prozessen oft übergangen werden.
Wir verstehen uns als Brücke – nicht als „Aber“, sondern als „Auch“. Als diejenigen, die darauf hinweisen, was fehlt, wer nicht mitgedacht wurde, wo es Lücken gibt. Weil eine wirklich so:lidarische Gesellschaft nur entstehen kann, wenn alle mitgestalten können
